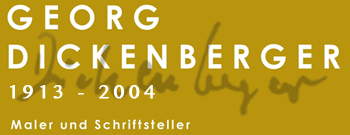Kritiken (Auswahl)
Gießener Allgemeine Zeitung 23.6.2001 Geboren wurde Georg Dickenberger 1913. Damit steht die Geschichte fast des gesamten zwanzigsten Jahrhunderts in enger Verbindung zu seiner Biografie. Sein Vater fiel im Ersten Weltkrieg (der Maler und Schriftsteller kann sich heute noch erinnern, wie seine Mutter die Nachricht von dessen Tod erhielt), er selbst gerät nach dem Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft. Nach 1945 baute er nicht nur sein zerstörtes Umfeld, sondern auch die Frankfurter Künstlerszene wieder auf. 1946 findet Dickenbergers erste Ausstellung in seiner Geburtsstadt Frankfurt statt. |
Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.7.99 Schon in den Fünfzigern, als Reisen noch ein Luxus waren, hat Georg Dickenberger mit seinen kulturhistorischen Beiträgen für den Hessischen Rundfunk eine große Zuhörerschar zu den Kunstschätzen der Welt entführt. Manch einen regten seine Betrachtungen zur Beschäftigung mit Kunst oder Literatur an, denn in beiden Disziplinen war Dickenberger überzeugend. Bis 1980 klangen seine Berichte und Reportagen zu kulturellen Ereignissen, vor allem aber zu bildkünstlerischen Themen, über den Äther. Denn ihnen galt Dickenbergers besondere Neigung, war er doch selbst ein Maler, der sich mit seiner Radioarbeit die künstlerische Freiheit finanzierte. |
Frankfurter Rundschau 17.4.97 |
Frankfurter Rundschau 19.11.1993 Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, daß Georg Dickenberger erstmals in Frankfurt ausstellte. Hier ist er am 7. August 1913 geboren, hat 1940 die Künstlergruppe "Junge Kunst" (die erste Frankfurter Künstlervereinigung der Nachkriegszeit, die indes nie den Bekanntheitsgrad der "Quadriga" erreichte) mitbegründet, hier arbeitete er literarisch und kunstkritisch, war als Illustrator und Hörspielautor beim Hessischen Rundfunk tätig, redete und schrieb in Radio und Presse über die Kunst anderer — und vernachlässigte bisweilen die eigene. Hier wurde er nun 80 Jahre alt |
Gießener Allgemeine 8.10.90 Er hat bewegte Zeiten gesehen und seinen Optimismus offenkundig nie verloren: Georg Dickenberger (geb. 1913) war zur Vernissage seiner Ausstellung selbst ins Alte Schloß am Brandplatz gekommen. Er strahlt positive Lebenssicht ebenso aus wie seine farbenfrohen, lebendig pulsierenden Bilder, die seit Freitagabend im Ausstellungsraum zu sehen sind. Der aus Frankfurt/Main stammende Künstler hat in seiner Heimatstadt, an die expressionistische Tradition Max Beckmanns anknüpfend, nach 1945 wesentlich an der Wiederbelebung der deutschen Kunst mitgearbeitet; er ist u. a. Gründer der Gruppe "Die junge Kunst". |
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.11.88 Bildende Künstler, die auch als Wortkünstler auftreten, galten lange Zeit als Doppelbegabungen. Heute ist das anders: Viele junge Maler schreiben auch, ob nun begabt oder nicht. Jedenfalls sind sie in keinem Zwiespalt, auf welchen Ausdruck sie sich konzentrieren sollten, auf das Bild oder das Wort. Mit einer ganzen Reihe von Einzel-Ausstellungen in Frankfurt, in Wiesbaden und Ludwigshafen wie auch in den Vereinigten Staaten, in Kanada und Irland hat Dickenberger seine Malerei zur Diskussion gestellt und rege Wirkung erzielt. Jetzt, im Jubiläumsjahr, zeigt er in der Kommunalen Galerie im Leinwandhaus eine Retrospektive auf seine Produktion vornehmlich des letzten Jahrzehnts. |
Rheinpfalz 18.9.71 Ludwigshafen. Mit einer Präsentation des grafischen Gesamtwerks des Amerikaners Jaspar Johns und einer gleichzeitig im Kleinen Binder-Saal des Relchert-Hauses gezeigten Auswahl von Bildern und Gouachen des Frankfurter Malers Georg Dickenberger steuert die Stadt Ludwigshafen die neue Saison an. Gemeinsamkeiten zwischen zwei höchst verschiedenen Temperamenten suchen zu wollen, wäre ein müßiges Unterfangen. Nur Individualisten sind sie beide auf ihre Welse, der Pop-Vater und der malende Literat. Während Jaspar Johns weltweit im Gespräch ist, muß man den 58jährigen Dickenberger zu den Stillen im Lande zählen. Der Mitgründer der Frankfurter Gruppe "Junge Kunst" wurde für lange Jahre durch seine literarischen und pädagogischen Arbeiten abgehalten. Im Binder-Saal des Reichert-Hauses lernt man in ihm einen Naturmaler besonderer Eigenart kennen. Einen, der die Auseinandersetzung auf seine Weise sucht. Genauer: Dickenberger geht es nicht um das Abbilden. Die Landschaft ist ihm vorwiegend Anregung, sich mit ihren Formationen und Strukturen zu befassen. Von da aus gelangt er ganz von selbst zu einer Art informeller Gestaltung, die gleichwohl den Ansatzpunkt zu erkennen gibt. Während er in dem frühen "Wasserfall" von 1947 die Farbe noch sehr behutsam einsetzt, hat er heute andere Mittel gefunden. Typisch ist für ihn die Gouache-Technik, die er vom Zeichnerischen her mit Vollage-Effekten eweitert. Klaus J, HoHmiinn |
Frankfurter Allgemeine Zeitung 25.10.69 ae. Frankfurt ist Ihm "so schön wie jede andere Stadt auch"; dieses Wort aus einer kleinen, liebenswerten Meditation über die Heimatstadt aus einer — später auch gedruckten — Sendung im Rundfunk kennzeichnet die Betrachtungsweise des Funkautors und Journalisten, bezeichnet das stets spürbare Bemühen, Menschen wie Dingen unbefangen gegenüberzutreten, ihnen gerecht zu werden. Mag diese Distanz, mögen Ironie und Selbstironie zunächst Unbeteiligtsein und Kälte vermuten lassen, die Leidenschaft des Malers Georg Dickenberger für seine Gegenstände belehrt rasch eines Besseren. So ist Frankfurt für ihn, um Im Zusammenhang des obigen Zitats zu bleiben, nicht einfach eine Stadt wie jede andere, denn aus mancherlei Gründen vermag er gerade sie mit "stillem, zärtlichem Glück" zu betrachten, und so ist sie für ihn, der die französische Hauptstadt liebt, "schön wie Paris". |
Frankfurter Rundschau 9.2. 1968 Droben unterm Dach des Frankfurter Karmeliterklosters, wo einige Künstler ihre Ateliers haben, sind auch die Ausstellungsräume des Berufsverbandes, wo zur Zeit Oelbilder, Aquarelle und Zeichnungen des Malers und Publizisten Georg Dickenberger gezeigt werden. Ein eiliger Passant wird sich selten dorthin verirren; in diesem Fall ist es auch gut so. denn die Bilder Georg Dickenbergers erschließen sich nicht dem schnellen, oft flüchtigen Blick. |
Abendpost 1951 Die Idee, in einem Theaterfoyer eine Bilderausstellung zu veranstalten, bietet wechselwirksame Reize. Für den Theaterfreund bedeutet sie eine farbige Ausweitung des Theaterbesuches und für den Ausstellenden die Begegnung mit zahlreichen Kunstinteressenten. Dank dem Frankfurter "Intimen Theater" 'am Börsenplatz für diese Vermittlung. |
Offenbach Post 1948 Man muß sich den Weg zwischen unkrautbewachsenen Schutthaufen zum Eingang der Villenruine Städelstraße 8 erst suchen, ehe man zu den intimen Atelierräumen gelangt, die der Frankfurter Maler Georg Dickenberger und die Bildhauerin Claire Bechtel in den hinteren Gewölben des zerbombten Hauses mit Geschmack einrichteten. |
Frankfurter Neue Presse 1948 Als die Bildhauerin Cläre Bechtel in das zerstörte Frankfurt zurückkehrte, war ihre erste Sorge das Atelier das sie sich dann in den Resten eines Trümmerhauses errichtete. |
Stimme der Arbeit 1948 Wir besuchten die Atelierausstellung Städelstraße 8, in der Claire Bechtel und Georg Dickenberger ihre Künste zeigen. Wer In unserer schönheitsleeren Zelt der wilden Spannungen die reinere Luft einer veredelten Welt atmen will, der lenke seinen Weg nach dem stillen freundlichen Atelierraum inmitten grüner Gartenlandschaft, den die Bildhauerin Claire Bechtel mit Opfern und großer Liebe aus Trümmern erschuf. Mit ihren Plastiken erhob sie ihn zu einer Stätte stiller Sammlung und erhabenen Genusses. Der Maler Georg Dickenberger, der im gleichen Raume ausstellt, gehört zu der Gruppe junger Künstler, die Im Ringen nach neuem Ausdruck mit Symphonien aus Farbe und Form unser besseres Selbst rühren und erheben wollen, die daher auf ihrem schweren Weg jede Unterstützung des Einsichtigen verdienen. Seine Behandlung des Materials zeigt den Weg, sie ist auch schon Erfüllung. Man lasse seinen "Bahnhof" und "Schiffbruch" auf sich wirken und erkennen, wie hier das Monstrum "moderne Technik" ohne Betonung des Gegenstandes, uns höhnisch grinsend entgegenspringt. Man versenke sich auch in seine "Flußlandschatt", in "Russische Kathedrale" und fühle, wie hier mit rein künstlerischen Mitteln der Eindruck von Gewaltigem und Lieblichem in unsere Seele gesenkt wird. Max Keller |